DATA:matters
Blog
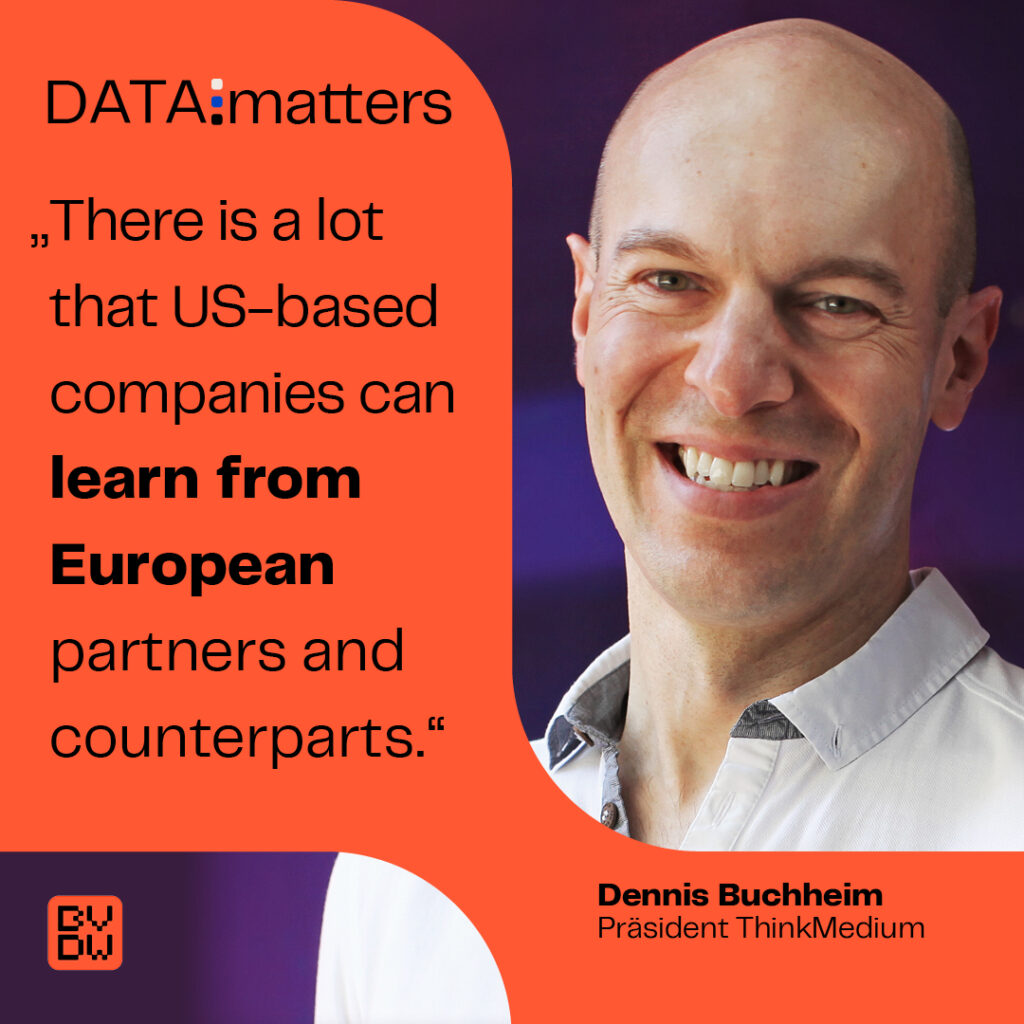
Interview Dennis Buchheim
The pace of change in the advertising ecosystem has been so rapid that the past decade covers a lot of ground. In that timespan, digital outpaced traditional media spend, mobile grew to be dominant, programmatic buying became the norm, creative evolved from display to video as the standard, and GDPR had an industry-shaping impact on data practices and privacy regulations – including in the US.
Along the way, the ecosystem became unhealthy: too many vendors collecting too much data and innovating in ways that didn’t always add enough value. With that said, partly because of the expanding range of privacy laws and platform policies that ostensibly reflect increased consumer awareness and concerns, ethical data use, respect for privacy, and data protection now sit front and center in industry conversations.
Heavier regulation by more stringent data privacy laws like GDPR has defined the European ecosystem, whereas the US privacy landscape remains more fragmented, with limited federal oversight and a patchwork of inconsistent state-level laws.
This has generally given US advertisers, publishers, and tech providers more leeway in their data practices (often only offering opt-in/out, deletion, etc. when legally required, for example), but additions to state-level regulations like those in California, new bills and laws in many other states, and platform policies by Apple and Google are bringing US data use and privacy practices closer to European standards. Many US ecosystem constituents are now waking up and making changes. With more countries joining in, as with DPDPA in India, it’s safe to say advertising is increasingly a globally regulated industry.
Certain US companies were quick to set GDPR as their “floor” for responsible data practices and started building and operating accordingly. Many others developed Europe-specific data exceptions and have been patching systems for the US ever since, waiting to see if further privacy laws are established. Arguably, Apple’s stance on consumer privacy and their browser cookie, “app tracking”, device identifier, and other changes also accelerated the industry’s reevaluation of data practices, as signals waned.
If you attend any US advertising board meeting today, it’s highly likely that GDPR or some of its core principles – or CCPA/CPRA as the US domestic benchmark – will be mentioned. Leading companies are no longer oblivious to data standards originally spurred or influenced by GDPR. But, when it comes to actually complying with these standards and planning for the evolution of their businesses in the face of continued regulation and cookie/ID deprecation, much work remains to be done.
Consumer concerns and awareness about privacy have steadily increased in the last five years, in part as a consequence of high-profile data breaches and data harvesting malpractices, and in part due to the privacy-focused actions and brand positioning of key ecosystem stakeholders – most notably Apple.
Consumers unquestionably want more transparency and control over their personal data today – and don’t really want their data to be used if it’s not providing them with clear value in return – and this may be just as true in the US now as it has been in Europe for some time. One challenge is how to provide transparency and control in a way that is clear, effective, and not overwhelming for consumers while communicating a compelling value exchange; more consistency across regions and especially platforms would be helpful in this regard.
With privacy in mind, Artificial Intelligence and Machine Learning create both opportunities and new challenges. Their ability to distinguish patterns in data can help bring greater utility to privacy-forward advertising solutions and make them less reliant on user-level data: conversion modeling, evolved contextual targeting, etc. On the flip side, Generative AI models come with their own risk of bias and potential privacy breaches involving the data used to train them.
Other technologies are having a demonstrable impact on data integrations and applications: privacy-enhancing technologies (PETs) can provide a layer of added privacy, which can be deployed through data clean rooms and other solutions. Interestingly, several such PETs (cryptography, differential privacy, etc.) are not new, some dating back to the 1980s with wide adoption in fields like healthcare, but are being dusted off to bring more data security into advertising solutions. Overall, emerging technologies are critical to building a more durable advertising ecosystem.
Overall, there is no single solution that will support the next phase of more private advertising, but there are certainly many options to consider.
First-party data has captured the most attention as a response, although this is not a viable solution for every ecosystem stakeholder category (not everyone has first-party data at scale), nor every advertising use case (it may not solve measurement as well as targeting, for example).
With much of the recent regulatory work aimed at curbing behavioral targeting, approaches like “next-generation” contextual targeting inherently gained new appeal. Shifting platform policies mean that making the most of signals provided through initiatives such as Google’s Privacy Sandbox or Apple’s SKAdNetwork is judicious, and present an opportunity for AI-powered solutions that can extract “signal” despite data aggregation and minimal individual data points.
Universal identifiers and other identity solutions promise a lot, but how they differ from historical user profile linkage and how resilient they will be to the expanding scope of personal data limitations (Hide My Email, IP address filtering, etc.) remains to be determined.
Finally, data clean rooms have unquestionably gained traction, although challenges remain and they are not a silver bullet: computing costs and better standardizing their underlying privacy guarantees are key considerations.
European advertising entities have definitely set the standard for more stringent data practices, given their regional privacy environment and compliance requirements.
There are countless anecdotes of US companies initially having to rethink their data practices and system designs to comply with European regulations in order to sustain business operations on the continent, and that process later permeating their domestic (US) data practices and future product roadmaps.
There is a lot that US-based companies can learn from European partners and counterparts – and there will be increasing collaboration required if the industry is going to solve a fairly foundational set of changes over the coming year or so. GDPR and its global spawn are foremost in this regard, but DSA and DMA are now gaining much more attention and causing companies to change their infrastructure and other practices.
It may be idealistic to say, and it also reflects my background as former CEO of IAB Tech Lab, but the more we can work together to define and develop standards and practices that can benefit consumers and save companies money as they navigate required (and non-differentiating) privacy-motivated changes, the better off we will be as an ecosystem.
Interview Maike Scholz
Die digitale Verantwortung als Handlungsprinzip zur verantwortungsbewussten Nutzung von Ressourcen hat in den letzten Jahren immer mehr Einzug gefunden, wenn man sich mit Digitalisierungsthemen beschäftigt. Mit Blick auf die nahende Klimakrise ist Digital Responsibility ein zentraler Faktor in Gesellschaft und Politik innerhalb kürzester Zeit geworden.
Zum einen ist die Digitalisierung aus unserem heutigen Leben und Arbeiten nicht mehr weg zu denken, also notwendige Basis, zum anderen werden aber mit dem Betrieb von Rechenzentren sowie der Produktion von Endgeräten oder digitalen Infrastruktur enorme Ressoucen jeglicher Art verbraucht. Hier kommt das Thema Datennutzung, dem Sammeln, Aufbereiten, Auswerten und damit der Steuerung der vorhandenen Daten, die im Rahmen der Digitalisierung anfallen, als entscheidender Faktor für Nachhaltigkeit ins Spiel: Denn nur durch die umfängliche Nutzung der vorhandenen Daten kann man Verbräuche gezielt messen, hieraus Rückschlüsse ziehen, diese mit anderen vergleichen und somit gezielt Maßnahmen einleiten, um den Ressourcenverbrauch zu minimieren und damit ein nachhaltiges Leben und Arbeiten sicher zu stellen.
Somit hat sich binnen kürzester Zeit ein boomendes Feld ergeben, welches die Datennutzung als essenzielleren Faktor zur nachhaltigen Digitalisierung katapultiert hat.
Die Digitalisierung ist Fluch und Segen zugleich: Zum einen trägt sie in erheblichem Maße zur Klimakrise bei, aber auf der anderen Seite sind unsere heutigen Umweltprobleme nicht mehr ohne die Hilfe von z.B. computergestützten Berechnungen oder der automatischen Steuerung von Verbräuchen in Wirtschaft und Verkehr zu bewältigen.
Um gezieltere Erkenntnisse über z.B. Verbrauchsverhalten, Warenströme bis hin zu globalen Korrelationen zu erhalten, werden weitere Daten zur Analyse benötigt, die aber nicht immer ohne Weiteres für die Datennutzung zugänglich sind. Gründe dafür sind z.B. Endnutzer, die aufgrund von falsch verstandenem Datenschutz Ihre Daten nicht zugängliche machen möchten oder auch Unternehmen, die mit Blick auf ihre Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse sich nicht an Plattformen zum Datensharing beteiligen.
Hier ist es weiterhin notwendig, auf der einen Seite die Nutzer über alle Ebenen (Staat, Verbände, Unternehmen) noch besser zu informieren und ein Allgemeinverständnis zu schaffen, was technisch im Rahmen der Weiterverarbeitung mit den geteilten Daten geschieht und ob und wie diese auf sie zurück verfolgbar sind. Die Aktionen des BVDW sind daher ein wesentlicher und kreativer Impuls, weil sie hier einen guten Überblick auch für diejenigen bieten, die sich nur aus Nutzerperspektive mit der Digitalisierung beschäftigen. Auf der anderen Seite, und das wirkt unmittelbarer, muss den Nutzern der Nutzen des Datensharings bei der Abfrage schon klar vermittelt werden: Ich bezahle mit meinen Daten z.B. guten, freien Journalismus, ich sorge mit der Freigabe meines Trackings für ein bestimmtes, nachhaltiges Projekt oder auch für auf mich abgestimmte Angebote/Werbung.
Der Nutzenaspekt spielt beim Thema Datasharing bei Unternehmen ebenfalls eine große Rolle: Gibt es Plattformen, im Sinne von Tauschbörsen, auf denen man einfach und mit Blick auf den gesetzlichen Rahmen seine Daten sharen kann, um so für sich an Date zu kommen, die nützbar für das eigene Unternehmen sind? Dem gegenüber steht der Aufwand, z.B. die eigenen Daten entsprechend zu strukturieren, von personenbezogenen Daten und Rechten Dritter freizumachen. Da solche Plattformen mit der Anzahl der Teilnehmer ihre Nützlichkeit für Unternehmen skalieren, würde das für eine zentrale, neutrale und nicht-kommerzialisierte Struktur sprechen. Hier wäre der Betrieb über die EU denkbar. Auch wäre zur Unterstützung und Beratung der Unternehmen bei den rechtlichen oder technischen Fragen ein, nennen wir ihn mal „Data-Sharing-Coordinator“ das Plattformbetreibers sinnvoll.
Aus dem Lebensumfeld denke ich natürlich an das Homeoffice, durch das man den Arbeitsweg ins Büro und damit direkte Emissionen spart. Die Digitale Vernetzung senkt somit die Umweltbelastungen, die aufgrund von Mobilität entstehen. Smarte Daten helfen darüber im Haus auch, den Energiebedarf zu optimieren oder den Mix aus verschiedenen Energiequellen reibungslos zu koordinieren.
Aber auch in der Wirtschaft sorgen Intelligente, datengetriebene Technologien dafür, dass Klimaemissionen und Ressourcen eingespart werden: Die Lebensdauer von Maschinen kann durch die zielgenaue Pflege und Wartung (Predictive Maintanance) erhöht werden und spart neben den Ressourcen für die Neuproduktion dem Unternehmen auch Kosten für die Neuanschaffung ein. Hier gewinnt das Feld „Smart Metering“ an extrem hoher Bedeutung, indem man mittels der Messung der Energienutzung und der Verbrauchszeiten datengetrieben den Verbrauch optimieren kann. Diese Daten können Unternehmen auch als Basis für Ihre Nachhaltigkeitsstrategie (und/oder für Ihr Nachhaltigkeitsreporting nutzen, um ihre Umweltziele zu definieren und gezielte Steuerungsmaßnahmen im Unternehmen einzuleiten.
Digitale Prozesse führen also zum einen zu einer Effizienzsteigerung, wodurch weniger Ressourcen verbraucht werden oder einer direkten Ressourcenvermeidung und der ökologische Fußabdruck wird kleiner. Über die Datennutzung erhalten wir darüber hinaus die Informationen, die benötigt werden, um gezielt weitere Ursachenanalysen und Maßnahmen zur Steigerung der Nachhaltigkeit und vielleicht gar zu einer Änderung des Nutzungsverhaltens zu betreiben.


Interview Christopher Reher
Ich bin mir nicht sicher, ob man hier von Unterschätzen sprechen kann. Vielmehr handelt es sich hier auf der einen Seite wahrscheinlich um tatsächliche Unkenntnis in Bezug auf die Tragweite der Materie, sowie auf der anderen Seite um eine gewisse Kurzsichtigkeit der Gesellschaft gegenüber ihrer eigenen digitalen Existenz.
Hier müssen wir uns, als digitale Wirtschaft, ganz sicher auch an die eigene Nase fassen.
Wir haben es in all den Jahren nicht verstanden positiv deutlich zu machen, was für einen unmittelbaren und immensen Mehrwert das Digitale für das Leben der Menschen mit sich bringt. Um es klar zu sagen: Alles Digitale ist immer auch von Daten angetrieben, man kann sagen, dass sich Digitales und Daten quasi gegenseitig begründen und synergetisch sind.
Schon heute profitiert jeder Mensch von Daten und Digitalem. Unsere Autos fahren auf der Basis von Daten und Profilen, unsere Handys funktionieren auf der Basis von Daten und unter anderem Profilen. Wenn wir über Themen wie Smart Home, künstliche Intelligenz, Big Data und derartiges sprechen, dann sprechen wir immer auch über Daten.
Nimmt man diese Tatsache an und sieht diese im Kontext des zusammenhängenden digitalen Wirtschaftsraumes, dann haben wir eine immense Größe an Umsätzen. Wir reden hier von Größenordnungen die allein in Deutschland mehr als 230 Milliarden Euro im Jahr betragen. Dies sind mehr als 5% des gesamten Brutto-Inlandsproduktes von Deutschland. Dabei ist zu beachten, dass hier die neuen Entwicklungen rund um die Elektrifizierung und Digitalisierung der Industrie noch nicht eingeflossen sind. Wir reden hier also auch von einer sehr großen Anzahl an Arbeitsplätzen, die, direkt oder indirekt, auf der Basis von Digitalem und Daten Ihr Leben bestreiten können.
Gleichzeitig ist das Digitale so sehr Bestandteil unseres Alltags, dass wir sagen können, dass annähernd jeder Deutsche, und eigentlich auch jeder Europäer, mittlerweile in irgendeiner Form von einem datengetriebenen Hilfsmittel in seinem Leben begleitetet und bereichert wird.
Nimmt man all dies zusammen, dann müssen wir uns eingestehen – auf allen Seiten der Gesellschaft -, dass wir hier aufgefordert sind, gerade auch zum Wohle der zukünftigen Generationen, des Wirtschaftsstandortes Deutschlands und des Wirtschaftsstandortes Europas, zu akzeptieren, dass Daten und Digitales elementare Bestandteile unseres Lebens sind.
Auf der Basis dieser Erkenntnis können wir Wissen teilen, Menschen mündig machen und proaktiv und Mehrwertgesteuert gestalten. Denn nur wenn wir mit allen gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Organen und Entitäten zusammenarbeiten, können wir eine gemeinsame, bessere digitale Version unserer Gesellschafft schaffen. Dies ist gerade jetzt notwendig, da Spaltung von allen Seiten droht.
Die Basis dieser gemeinsamen Vision bietet eine leistungsfähige und starke deutsche digitale Wirtschaft, mit ihren herausragenden Entwicklungen und Informationsangeboten.
Für diesen Dialog stehen wir immer bereit und gerade Veranstaltungen wie die BVDW- Themenwoche DATA:matters sind Veranstaltungen, die diesen Dialog fördern und auf den wir uns sehr freuen.
Ganz besonders glücklich sind wir natürlich darüber, dass mit dem Bundesminister für Digitales und Verkehr, Herrn Wissing, hier auch prominente Unterstützung für diese Initiativen gegeben ist.
Am Anfang steht hier immer das Wissen.
Wir müssen Wissen schaffen und in einem gemeinsamen Dialog einen Weg finden, alle gesprächsbeteiligten, und ich meine wirklich alle gesprächsbeteiligten und betroffenen Menschen, mündig in der Materie des datengetriebenen Lebens zu machen.
Mündig heißt in diesem Punkt, zumindest fähig zu sein, an dem ganzen System oder an der digitalen Welt zu partizipieren und den Mehrwert, den diese bringt, für sich zu nutzen.
Das heißt mitnichten, dass beispielsweise jeder Mensch exakt verstehen muss, wie das Auto und der Motor funktionieren, sondern, dass wir als Gesellschaft uns selber in die Situation versetzen, in der wir – um in der Analogie zu bleiben – das Auto fahren und sicher im Verkehr bewegen können.
Hierzu ist es wichtig, dass auf der politischen Seite Ohren, Herzen und Verstand offen sind für Dialog, Vorschläge und Entwicklungen aus der Wirtschaft. Gleichzeitig muss die Wirtschaft ihrer Verantwortung gegenüber der Gesellschaft noch mehr nachkommen und eben auch Informationsangebote machen. Am Ende ist es gerade die Wirtschaft, die genau diese Entwicklung genau dieser Digitalisierung geht, um dem Endverbraucher ein noch besseres Produkt zu geben. Gleichzeitig müssen gerade auch Datenschutzbehörden und Verbraucherschutzorganisationen willens sein, nicht nur singulär besonders hohe Schutzmechaniken zu etablieren, sondern zu erkennen, dass der Endverbraucher schon heute digital leben will, digital partizipieren will.
Es kann also nicht ein Kampf gegenseitiger konträrer Interessen sein. Es muss vielmehr um die Harmonisierung der Sichtweisen zum Wohle des digitalen Menschen gehen.
Kernaufgabe des Ressorts Data Economy ist es zu übersetzen, aber auch umzusetzen. Zu übersetzen zwischen Recht, Politik, Technologie, Wirtschaft und Bürger.
Um dieses Ziel zu erreichen, haben wir von den im BVDW beteiligten Mitgliedsunternehmen Deutschlands beste Digitalexperten, ich scheue mich nicht zu sagen: Europas beste Digitalexperten, versammelt und mit dem klaren Auftrag versehen, hier Wissen so neutral wie möglich zu aggregieren und leicht verständlich verfügbar zu machen.
Weiterhin haben wir im Rahmen der Ressorts Data Economy Rechtsstandards mitentwickelt, um den Rechtsverkehr und die sichere Handhabe von datengetriebenen Geschäftsmodellen zu ermöglichen und zu stabilisieren. Wir sind intensiv im Austausch mit Behörden und politischen Entscheidungsträgern zu Fragen von Einwilligungs-Logiken und technologische Standards der vernetzten Datenverarbeitung. Daraus folgend beschäftigen wir uns mit Themen der Big Data, sowie in der Breite zu weiteren Bereichen wie Smart Home und AI, da alle Bereiche im Kern aufeinander einzahlen.
Im Ressort Data Economy sind auch die Bemühungen rund um die universitäre Zusammenarbeit verortet, da wir immer wieder feststellen müssen, dass auch in der Forschung ein Wissensdefizit in Bezug auf den State of the Art bestehen kann, da schlicht der tiefe Praxisbezug nicht immer unmittelbar gegeben sein muss und kann. Gleichzeitig sind die wissenschaftlichen Erkenntnisse, gerade aus dem psychologischen Bereich, auch in Bezug auf die Datennutzung von hohem Wert in der Analyse des Diskurses zwischen Wirtschaft und Nutzer.
Deswegen gehen wir immer stärker auch in den universitären Bereich mit hohem personellem Investment an Projekte, um den Austausch zwischen den Experten und den unmittelbar Forschenden zu fördern, weil diese Informationen sonst nicht zur Verfügung stünden. Dies hilft wiederum auch den Studierenden, da diese direkt in der Praxis sehen können, wie moderne algorithmische und sonstige datengetriebene Geschäftsmodelle gebaut werden.
Hier kommt uns zugute, dass wir mit den beteiligten Unternehmen an der vordersten Front der digitalen Entwicklung stehen und folglich schon jetzt Themen und Anwendungen besprechen, die den Markt eher erst in 2 bis 3 Jahren wirklich erreichen werden.
Abschließend bündeln wir die Initiativen zu einer tatsächlich positiv verbundenen, digitalen Gesellschaft in der Connected Economy. Die Connected Economy ist auch der Anknüpfungspunkt für die BVDW-Initiative „Deine Daten können das!“ . Diese konsumentenorientierte Aufklärungsinitiative zeigt den Bürgern den positiven Effekt, welchen Daten und Digitales schon jetzt auf Ihre Leben haben. Dies zum Beispiel in Form von Frühwarnsystemen in Bezug auf die Gesundheit, Navigationsgeräten zur Stauvermeidung und der Anpassung von Inhalten für die beste Nutzererfahrung.
Hier gibt es mannigfaltige Beispiele.
Um nur ein paar zu nennen: nachdem der Gesetzgeber uns aufgegeben hat, Informationspflichten gegenüber den Nutzenden darzustellen, haben wir unter großem Aufwand eine Standardisierung, sowohl für die Darstellung dieser informativen Inhalte als auch für die Übermittlung der rechtserheblichen Signale, entwickelt und erfolgreich etabliert. Wir sind damit wahrscheinlich die erste Branche überhaupt, die eine derart große Menge an Informationspflichten a) nicht nur ableistet, sondern b) auch in der Lage ist diese dokumentationsfähig und mit internationaler Reichweite, technisch abzubilden.
Wir haben darüber hinaus rechtliche Standards für die gemeinsame Datenverwendung geschaffen und gesetzt, die schon jetzt in anderen Branchen als Grundlage genutzt werden. Diese JCA-Standards wurden auch international, unter anderem in der Schweiz und Österreich, adaptiert.
Wir sind intensiv mit unseren Experten im internationalen Austausch, unter anderem in W3C, über Fragen der Gestaltung und der rechtssicheren und für Verbraucher positiven Gestaltung des Internets. Wir kämpfen jeden Tag dafür, Verbraucherschutz, Datenschutz und wirtschaftliche Tragfähigkeit miteinander zu verbinden.
Wir sind als Vertreter von mehr als 1000 Unternehmen unmittelbar an dem Wohlergehen der Nutzer und der Bürger interessiert, denn diese sind das Lebensblut der Unternehmen, die wir vertreten.
Das Digitalgeschäft zu betreiben, ohne dabei verantwortungsvoll mit Daten umzugehen ist aus unserer Sicht nicht zielführend, nicht möglich und am Ende immer auch geschäftsschädigend.
Deswegen committen wir uns deutlich und immer wieder zu einem verantwortungsvollen, mündigen Umgang mit Daten, der das Leben bereichert und die neuen Möglichkeiten und Chancen schafft.
Zusammenfassend kann man sagen, dass wir uns als wichtiger bzw. als der Gesprächspartner sehen, der echtes und belastbares Wissen, über alle derzeit diskutierten technologischen und gesellschaftlichen Entwicklungen im Digitalen, mitbringt.
Der BVDW steht als Gesprächspartner an der Seite der Menschen, der Politik, der Gesellschaft und allen anderen Beteiligten, um digitales Leben – aber vor allem auch den digitalen Binnenmarkt Europas – zu ermöglichen und sicherzustellen, dass Demokratie und Freiheit durch Daten und Digitales ermöglicht und gestärkt werden. So werden wir im internationalen Wettbewerb unserer besonderen Verantwortung gerecht, und sind ein Beispiel für alle, die digitales Leben lebenswert machen wollen.
Meine persönlichen Erwartungen an diese Woche sind, dass wir genau diesen positiven Dialog endlich noch weiter vorantreiben, und dann in gemeinsame Initiativen überführen. Das wir nicht mehr an verschiedenen Seiten der Gräben stehen, sondern dort Brücken bauen, wo vorher keine waren.
Wir müssen den Dialog zwischen den Partnern nicht nur über diese Woche, sondern tatsächlich weit darüber hinaus gestalten und möglich machen, und so den digitalen Binnenmarkt Europas stärken und mit positiven Ergebnissen und Standards für die Zukunft fit machen.
Interview Stephan Noller
CSRD steht für Corporate Sustainability Reporting Directive – ein neues Gesetz der EU, das regelt, wie Unternehmen über Ihren Carbon Footprint und andere Aspekte von Nachhaltigkeit berichten müssen. Die CSRD zwingt aber nicht nur zu berichten, sondern den CO2 Footprint auch ständig zu reduzieren.
Unternehmen müssen in Zukunft in Ihrem Geschäftsbericht über Ihre Nachhaltigkeitsmassnahmen und Kennwerte dazu berichten, und sich zu Reduktions-Zielen verpflichten. Dabei müssen nicht nur die eigenen direkten Emissionen betrachtet werden, sondern auch alle indirekten durch Zulieferer oder solche, die durch in Verkehr gebrachte Produkte verursacht werden.
Zum einen ist es eine Herausforderung alle Daten erstmal zu ermitteln und zusammenzutragen. Doch dann kommt schnell auch die Herausforderung den Footprint tatsächlich auch kontinuierlich zu reduzieren. Da ca. 80% des Footprints in den indirekten Emissionen liegen muss der Fokus der Massnahmen vor allem dahin gehen.
Zum einen hilft die ESG Data Exchange bei der Erfassung der Emissions-Daten – dabei werden parallel vom bvdw und seinen Gremien Standards dafür erarbeitet. Vor allem aber hilft die Exchange dabei aus den ESG Daten auch einen geschäftlichen Vorteil zu generieren indem man Kunden neue, besser auf Nachhaltigkeit optimierte Produkte anbieten kann.

Disruption durch Daten: 3 Key Takeaways
Daten bieten die Möglichkeit zur Disruption. Die Experten Thomas Fuchs (Datenschutzbeauftragter der Hansestadt Hamburg), Kai Ebert (GM Valtech DACH) und Jonas Rashedi (CDO FUNKE Mediengruppe) haben in ihrem Talk heute die folgende Frage diskutiert: “Ist Disruption durch Daten Chance oder Risiko?” Im Fokus standen der gesellschaftlichen Blickwinkel, die Notwendigen Hebel, um Chancen zu erkennen und wie Datennutzung für alle gewinnbringend sein kann.
Das sind unsere 3 Key Takeaways:
Die Gesellschaft profitiert ganz klar von technischen Neuerungen, die auf der Nutzung von Daten basieren. Beispiele wie ChatGPT zeigen deutlich, welche Arbeitserleichterung mit den Entwicklungen einhergehen kann. Dabei stoßen wir auch an datenschutzrechtliche Grenzen, wie Thomas Fuchs mit Blick auf die Einwilligung bei einer sprachbasierten KI feststellt: “Die Vorhersehbarkeit, was mit meinen Daten passiert, die Frage der Zwecke, zu denen sie weiterverarbeitet werden, also die ganze datenschutzrechtliche Logik passen auf die ganzen Systeme nicht.” Die bisherige Strukturierung der Consentsysteme stoße dort an seine Grenzen.Eine klare Kommunikation und Transparenz über die Nutzung von Daten schafft Vertrauen . Für Kai Ebert sind dies zwei wichtige Voraussetzungen. Thomas Fuchs sieht dies ähnlich und stellte fest, dass sich die Wahrnehmung von Daten als Mehrwert und deren Nutzen in der Gesellschaft rapide geändert haben. Dies sei nicht nur in der nachwachsenden Generation, sondern in der gesamten Gesellschaft der Fall.
Die öffentliche Hand etabliert sich zunehmend im Markt. Behörden werden immer wichtigere Akteure im gesamtgesellschaftlichen Kontext der Datenverwendung. Die Datennutzung und das Teilen seien inzwischen ein gesamtgesellschaftliches Thema geworden, unterstrich Thomas Fuchs: Behörden stünden erstmals vor der Frage, wie sie die Daten, die sie bei sich haben, der Gesellschaft zur Verfügung stellen. Dabei sei es noch ein ganz langer Weg – insbesondere bei den Behörden – der zu gehen ist.
Für Unternehmen ist es besonders wichtig, Zuständigkeiten für Datenthemen festzulegen. Jonas Rashedi spricht in diesem Zusammenhang von den drei Pfeilern: Organisation, Architektur und Kultur. Diese drei Punkte müssen im Unternehmen festgelegt werden. Beim Punkt Architektur ergänzt er: “Wir Deutschen sind gut darin, immer neue, eigene Architekturen aufzubauen, statt sich einmal einzuholen, was aktuell Standard ist.”
Bei der morgigen Konferenz tauchen wir noch einmal tiefer in die rechtlichen und politischen Rahmenbedingungen ein. Stay tuned!
Interview Stefan Mohr
Ohne Daten geht im Digitalen so gut wie gar nichts. Interaktivität wäre eingeschränkt, Inhalte wären statisch, Nutzererlebnisse wären limitiert. Die Nutzung von Daten ist Mainstream in digitalen Kampagnen, Werbeformen, Plattformen, Produkten, Kampagnen. Kreativ wird es dann, wenn Daten überraschend genutzt werden, um emotional zu begeistern oder einen Mehrwert zu liefern. Datenpunkte auszulesen, um Vorhersehbares auszuliefern mag gut funktionieren, ist aber nicht zwingend kreativ. Kausalitäten aus Daten herzustellen, die nicht offensichtlich herauslesbar sind und damit oder darauf aufbauend kreative Arbeiten zu entwickeln, die einen positiven Beitrag in der Nutzung erzielen – das empfinde ich als kreativ.
Digitalagenturen sind als Partner ihrer Kunden intrinsisch motiviert, mehr als nur das Offensichtliche zu tun. Lediglich Briefings entgegennehmen und undiskutiert abarbeiten widerspricht ihrem Qualitätsanspruch. Für den Umgang mit Daten bedeutet das, dass sie nicht einfach das Bestehende untermauern, sondern dass aus diesen Daten Korrelationen, Kausalitäten, Muster herausgelesen werden, die zu einer neuen, überraschenden Form der digitalen Ansprache führen. Mit dem Blick der Spezialisten sehen Agenturen mehr als ihre Kunden und können digitale Kreation mithilfe von Daten erarbeiten, auf die man aus der Innensicht heraus vielleicht nicht gekommen wäre.
Zunächst einmal: Mir fallen bestimmt keine Beispiele ein, bei denen nicht auch in irgendeiner Form Daten Grundlage oder Bestandteil für die kreativen Highlights beim Deutschen Digital Award waren. Herausstechend sind diejenigen, bei denen sich das ‚wir verwenden explizit Daten für Kreativität‘ nicht so in den Vordergrund drängt, sondern bei denen sich die offensichtlich erlebbare kreative Höchstleistung durch einen unterschwelligen, eher selbstverständlichen Einsatz von Daten zeigt.

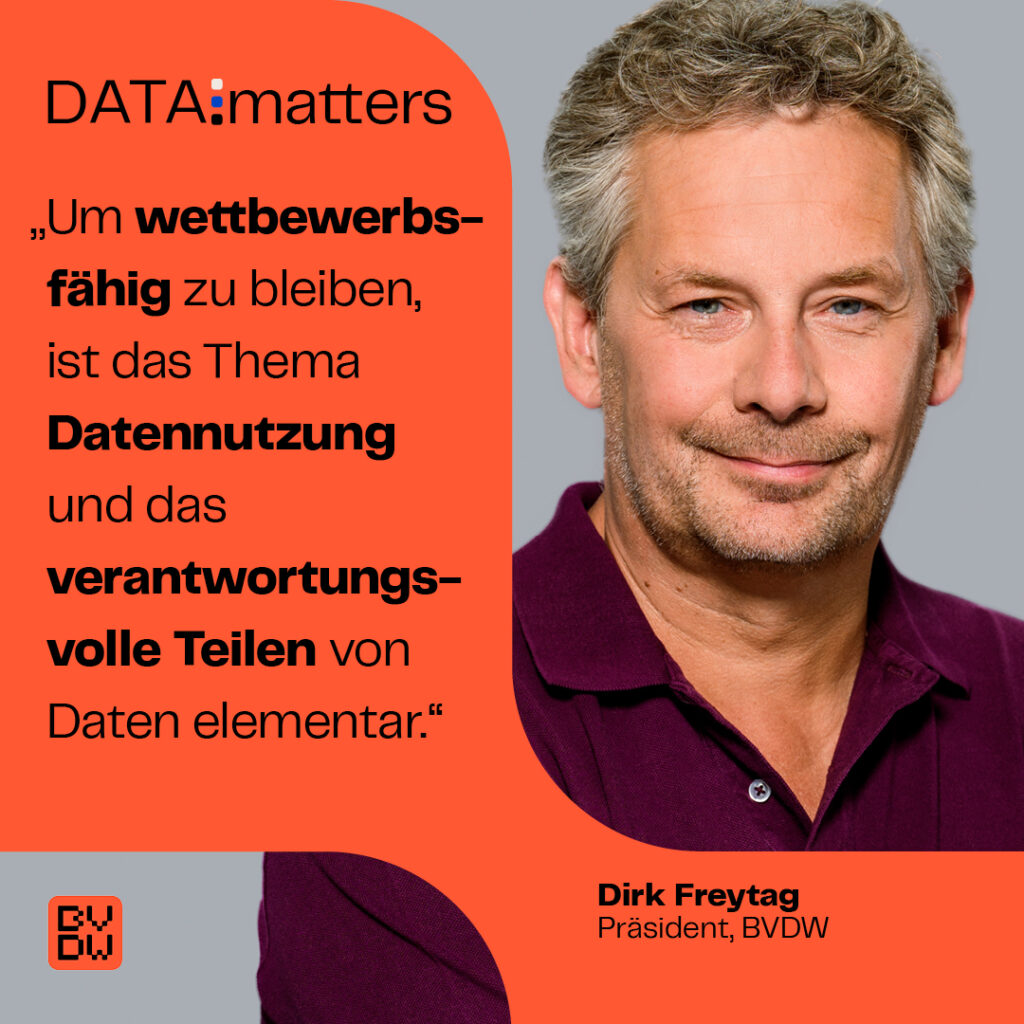
Wie gelingt der Spagat zwischen Datennutzung und Datenschutz?
Die Bundesregierung hat dieses Jahr in Meseberg die Datenstrategie verabschiedet. Sie greift dabei unsere wichtige Forderung auf, Chancen der Digitalisierung und Datennutzung in den Vordergrund zu stellen.
Aber wie sehen die verschiedenen Verantwortlichkeiten von Gesellschaft, Wissenschaft, Wirtschaft und Politik überhaupt aus?
Darüber diskutieren wir bei der DATA:matters-Konferenz am Mittwoch.
Wie können wir das kreative Potenzial von Daten ausschöpfen?
Bei DATA:matters dreht sich morgen alles um die Verknüpfung zwischen Daten und Kreativität. Wir zeigen Euch anhand spannender Use-Cases, welche Power in innovativer Datennutzung stecken kann.
Auf unserem Panel zum Thema „Disruption durch Daten“ stellen wir uns morgen außerdem die Frage, welche Risiken mit den neu gewonnen Chancen einhergehen können.


„Wir zeigen, welches Innovations- und Zukunftspotenzial in Daten steckt.“
Das ist das Ziel unseres Geschäftsführers Carsten Rasner für DATA:matters.
Die BVDW-Themenwoche startet heute! Bis Freitag beleuchten wir die unterschiedlichen Aspekte rund ums Thema Daten.
Wer einen ersten Eindruck von unseren Themenschwerpunkten für DATA:matters erhalten möchte, dem empfehlen wir die aktuelle Folge des #digitalexperten-Podcasts mit Carsten Rasner, Dirk Freytag (BVDW Präsident) und Anke Herbener (BVDWV Vize-Präsidentin).
3 Speaker Facts: Kai Zenner
📣 Kai Zenner ist Head of Office and Digital Policy Adviser für Axel Voss im Europäischen Parlament.
📣 Derzeit ist er u.a. an den politischen Verhandlungen zum AI Act und der Überarbeitung der DSGVO beteiligt.
📣 Er beschreibt sich selbst als Digitalenthusiast und hat den Fokus seiner Arbeit auf KI, Daten und den digitalen Wandel in der EU gesetzt.
Kai Zenner wird auf dem Panel „KI Anwendungen in Europa – Was bringt der AI Act?“ am Mittwoch, 15. November, als Speaker mit dabei sein.


Welchen Ansatz verfolgt die Bundesregierung?
3 Speaker Facts: Sascha Pallenberg
📣 Sascha Pallenberg gewann in vier aufeinanderfolgenden Jahren (2010-2013) den „Top 20 Smart Mobile Device Pundit“ Award für die einflussreichsten Blogger und Journalisten im Bereich Mobile Computing.
📣 2015 wurde er mit dem „Goldenen Blogger“ als Blogger des Jahres in Deutschland ausgezeichnet, bevor er im Februar 2017 als Head of Digital Transformation in die Unternehmenskommunikation der Daimler AG wechselte.
📣 Seit 2021 ist er Chief Awareness Officer bei aware_, Deutschlands erster Nachhaltigkeitsplattform, und begleitet Branchen bei ihren nachhaltigen Transformationsprozessen.
Sascha Pallenberg wird auf dem Panel „KI Anwendungen in Europa – Was bringt der AI Act?“ am Mittwoch, 15. November, als Speaker mit dabei sein.


Treffen im Bundestag
Am 11. Oktober hat sich der BVDW mit Dr. Jens Zimmermann, MdB digitalpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, im Bundestag getroffen.
Dabei standen vor allem die Themen Künstliche Intelligenz und der AI-Act, die Umsetzung des Digital Services Act sowie Datennutzung und Datenschutz im Mittelpunkt.
Dr. Jens Zimmermann wird bei unserer Themenwoche als Speaker beim Parlamentarischen Abend am 15.11. dabei sein.
Bild v.l.n.r.: Janek Kuberzig, Referent Politik & Gesellschaft, Dirk Freytag, Präsident BVDW, Dr. Jens Zimmermann, MdB, Daphne van Doorn, Senior Public Affairs Managerin
